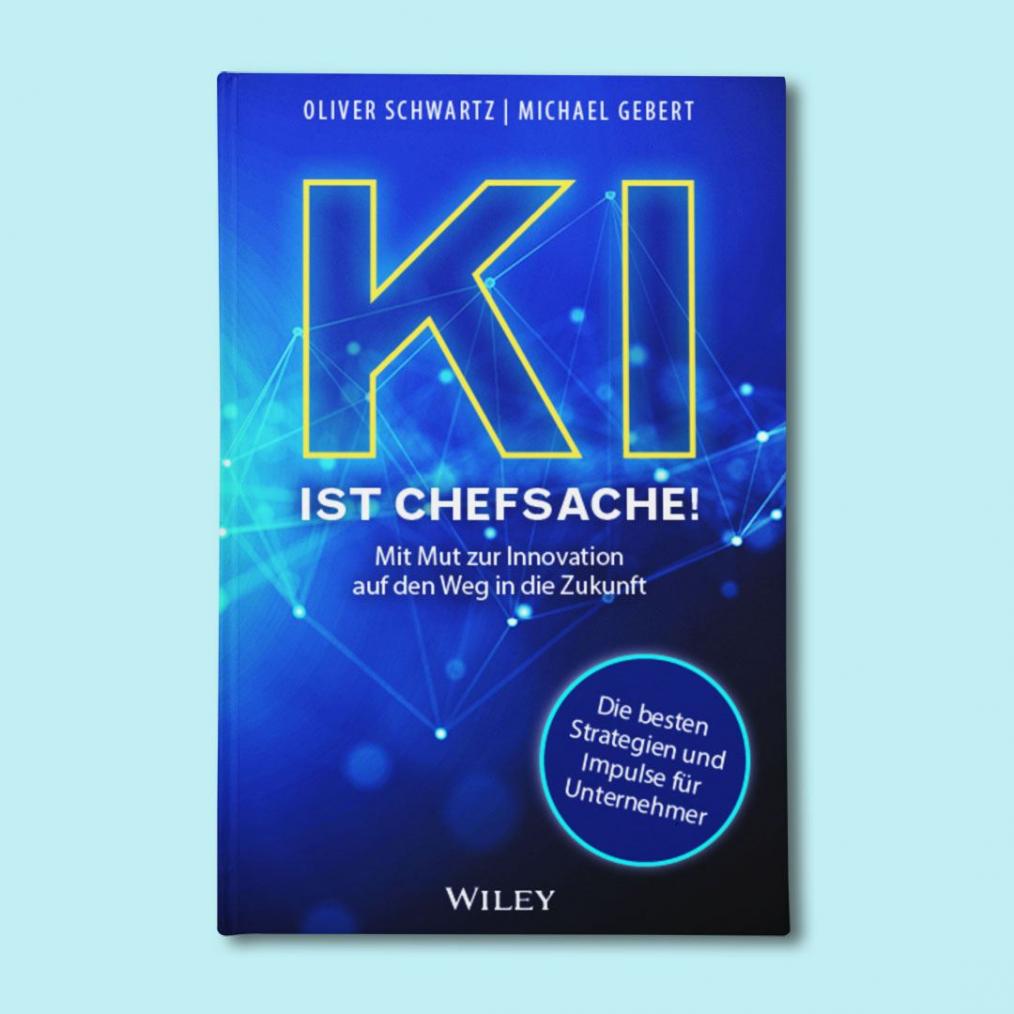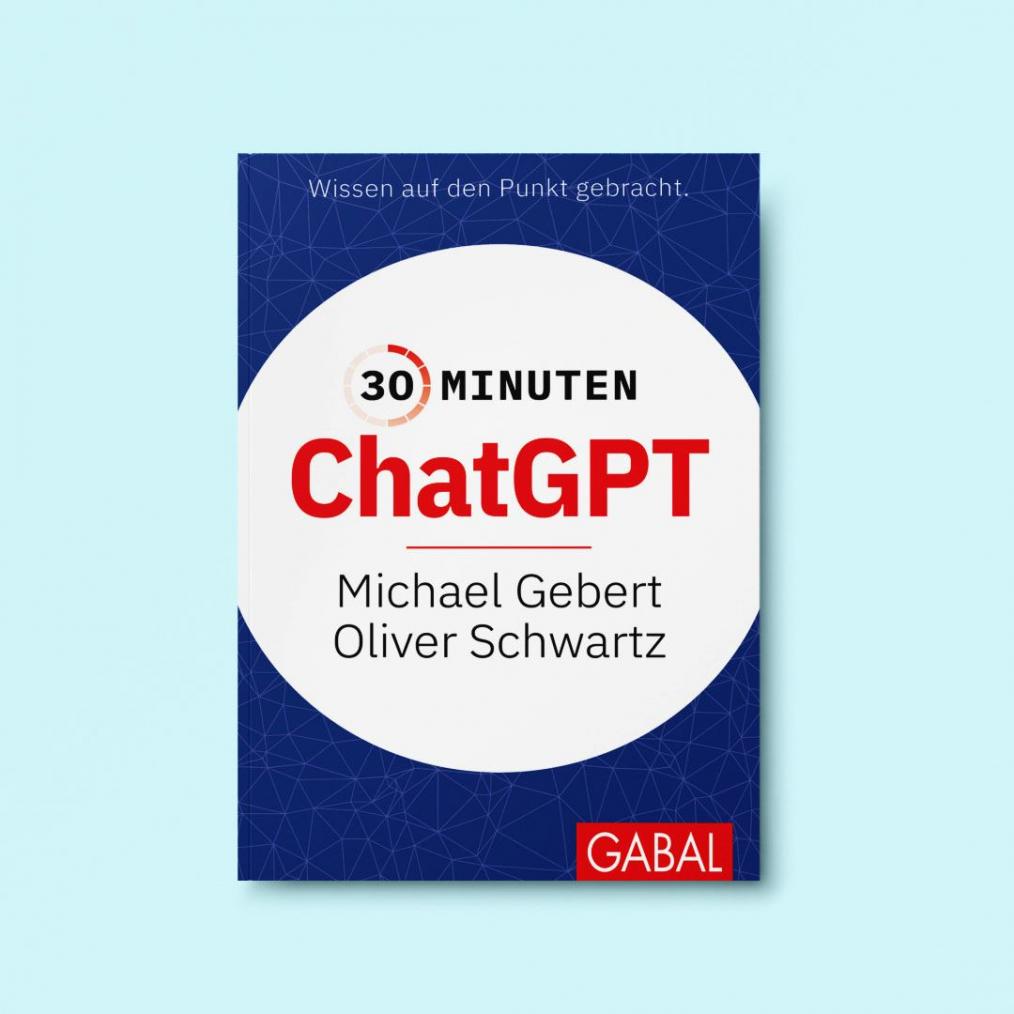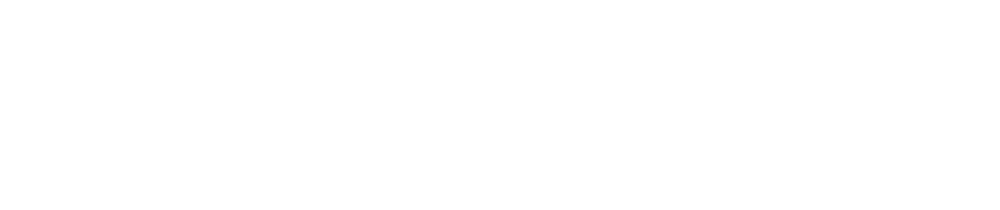Donnerstag, 7. August 2025 von Oliver Schwartz
Donnerstag, 7. August 2025 von Oliver Schwartz Debatte um Einsatz von KI in politischen Ämtern
Schwedischer Premierminister in der Kritik
Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson nutzt regelmäßig Künstliche Intelligenz, um sich eine Zweitmeinung einzuholen. Damit ist er keineswegs allein, wie er betont. Sein Pressesprecher bekräftigt, daß Kristersson keine sicherheitsrelevanten Informationen mit der KI teile. Die teils scharfe Kritik, die er derzeit in Schweden erntet, stößt weltweit auf Aufmerksamkeit und knüpft an eine durchaus nicht neue Debatte über den Einsatz von KI in der politischen Entscheidungsfindung an. Die Professorin Virginia Dignum der Universität Umeå bezweifelt den Wert der Künstlichen Intelligenz als Ideengeber oder Sparringspartner von Politikern und verweist auf die ethische Kernfrage: Die Bürger wählen Menschen als Volksvertreter und keine Chatbots.
Ulf Kristersson selbst hat die Kritik an seiner Nutzung von ChatGPT und LeChat damit befeuert, daß er sich nicht als moderner Politiker präsentiert hat, der sich aus Interesse mit der Künstlichen Intelligenz beschäftigt, sondern den KI-Tools in Interviews und Statements eine Art Berater-Rolle für die tägliche, politische Arbeit von ihm und seinen Kabinettskollegen zugeschrieben hat.
Nicht nur in Schweden wird nun darüber gestritten, ob sich Politiker für Ihre entscheidungsreiche Arbeit mit Hilfe von KI-Tools über historische und aktuelle Perspektiven, Zusammenhänge und Optionen informieren du gar Zweitmeinungen zu eigenen Positionen einholen sollten. Während Unterstützer betonen, daß der Premier nichts anderes mache als auch moderne Manager in Unternehmen, sorgen sich Kritiker um die Neutralität und Belastbarkeit von KI-Informationen und Ratschlägen – und darum, daß doch -bewußt oder unbewußt- vertrauliche, sensible Informationen mit der KI geteilt werden könnte.
Ethiker begrüßen die aktuelle, aus ihrer Sicht längst überfällige, Debatte. Denn es brauche ein gemeinsames Verständnis der KI-Einsatzfelder und Grenzen. Es könne nicht sein, daß einerseits im Zuge der Digitalisierung auch der konsequente, gewinnbringende Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Verwaltung und Bürgerdiensten eingefordert werde und andererseits „moderne“, technologieoffene Spitzenpolitiker und Regierungsvertreter sich mit der KI-Nutzung in einer Grauzone bewegen.
Befragt Donald Trump ChatGPT nach angemessenen Zöllen?
In der Diskussion wird deutlich, daß es den Kritikern vor allem um die großen, gesellschaftsrelevanten Entscheidungen geht und natürlich um Fragen von Sicherheit sowie Krieg und Frieden. Politische Felder, in denen Regierungen bislang auf Experten, Gremien und Sicherheitsberater gesetzt haben. Befragt Donald Trump ChatGPT nach angemessenen Zöllen und erklärt ihm der Chatbot die Welt? Konsultiert Benjamin Netanjahu die KI im Streit um das Vorgehen in Gaza? Und hätte eine Künstliche Intelligenz Jens Spahn eventuell von seiner Idee eines Open House Beschaffungsverfahrens für Corona-Masken abgehalten. Ethische und völkerrechtlich rote Linien sind immer noch autonome KI-Entscheidungen über Angriffe und das Töten von Menschen. Andererseits treffen Politiker auch tagtäglich weniger spektakuläre Entscheidungen, die jedoch ebenfalls das Leben, die Gesundheit und die Vermögensbildung von ihren Bürgen sowie Fauna, Flora und das Klima maßgeblich beeinflussen können. Welche Kriterien machen die KI zum nützlichen Werkzeug in der politischen Tagesarbeit oder verbieten deren Nutzung? Und ist es nicht ein erhebliches Sicherheitsrisiko, wenn Regierungsmitglieder freihändig entscheiden, welchen Chatbot und welches Sprachmodell sie nutzen? Aus vielen dieser Fragen wird nach Ansicht von Beobachtern deutlich, daß die Debatte überfällig ist – nicht nur in Schweden.
Professorin Dignum wird mit der Warnung zitiert, je mehr sich Staatenlenker wie Kristersson auch bei vermeintlich einfachen Dingen auf KI verlassen, desto größer ist das Risiko eines übermäßigen Vertrauens in die Künstliche Intelligenz. Das sei aber ein „rutschiger Abhang“. In Deutschland gibt es bislang noch keine vergleichbare Debatte um die Nutzung von Künstlicher Intelligenz durch den Bundeskanzler Merz oder sein Kabinett. Im Gegenteil wird regelmäßig ein Nachholbedarf reklamiert. Im jüngsten Bundestagswahlkampf spielt die KI auch programmatisch eher eine nachrangige Rolle und findet sich eher als diffuse Zukunftshoffnung in weiten Teilen des Koalitionsvertrags. Gewarnt wird viel mehr vor den Auswirkungen von KI-Nutzung im Wahlkampf und den Risiken von manipulativen Desinformationskampagnen.
Politik ist der Antrieb, Neues zu gestalten und Gerechtigkeit zu schaffen
Manchen Parlamentariern und Politik-Beobachtern dürfte angesichts der Debatte in Schweden eine Keynote der ehemaligen Bundestagpräsidentin Bärbel Bas beim letztjährigen Treffen von G7-Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten in Verona in Erinnerung kommen. Sie vermutete, daß in jedem der Plenarsäle ChatGPT sinnbildlich schon am Rednerpult stand. Es sei kein Geheimnis, daß manche Abgeordnete KI für ihre Reden nutzen. Die heutige Bundesarbeitsministerin thematisierte in ihrer Rede viele positiven Potentiale der Künstlichen Intelligenz, gerade auch für Bürgerdienste und Partizipation. Aber sie betonte auch: „Was wir brauchen, ist eine digitale Allgemeinbildung. Das heißt: Kompetenzen und eine Haltung zum kritischen Denken. KI-Nutzung heißt nicht, sich zurückzulehnen und das Steuer der KI zu überlassen.“
Und weiter: „Die KI ist von Menschen gemacht. Sie ist ein Werkzeug, das vor allem auf Daten der Vergangenheit basiert. Per se weder gut noch böse. Sie kann Menschen nicht ersetzen: Sie kann keine Wertentscheidungen treffen. Deswegen bin ich auch überzeugt: KI ersetzt nicht die politische Entscheidung oder gar die Demokratie! Auch wenn manche Bürgerinnen und Bürger denken mögen: Die Politik sei korrupt und eine neutrale KI solle die Entscheidungen treffen. Politik aber ist nie nur ein Blick auf Daten aus der Vergangenheit. Politik ist nicht die simple Reproduktion bekannter Muster. Politik ist der Antrieb, Neues zu gestalten und Gerechtigkeit zu schaffen. Natürlich auf Basis von Informationen. Aber mit ethischen und moralischen Maßstäben. Dafür braucht es menschlichen Verstand!“
Sicherheitsrisiken unüberschaubar?
Die auch von Bärbel Bas bei der Gelegenheit geforderte „breite, gesellschaftliche Debatte“ steht in Deutschland und vielen Ländern aus. Der Fall des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson kann hier einen Beitrag leisten.
Jenseits der hitzigen Diskussion über den KI-begeisterten Regierungschef geht es weniger um ein Verhindern von Künstlicher Intelligenz im politischen Tagesgeschäft, sondern vielmehr um Transparenz und Regeln. So wie amtliche E-Mails und die Protokolle von Kabinetts- und Gremiensitzungen protokolliert und gesichert werden, sollte dies -so Experten- auch für die Prompts und KI-Chatverläufe von Amtsträgern und Regierungsmitgliedern gelten. Und sowohl Politiker wie auch ihre Berater und Expertengremien sollte verpflichtet sein, Ideen und Handlungsoptionen, die eine KI beigesteuert hat, transparent zu benennen.
Ansonsten, so der schwedische KI-Berater Jakob Ohlsson, seien die Sicherheitsrisiken unüberschaubar. Er frage sich, warum der Premier Chatbots, „Zufallsgeneratoren“, für Ratschläge nutze, anstatt auf seinen "großen und gutbezahlten Stab von Experten" zurückzugreifen. ■
#kiinpolitik #künstlicheintelligenz #ulfkristersson #chatgpt #lechat #regierungsarbeit #politikundki #digitaleverantwortung #ethikundki #virginiadignum #umeauniversität #bärbelbas #demokratieundki #digitalebildung #kritischesdenken #kiundethik #disinformation #wahlkampf2025 #jensspahn #donaldtrump #benjaminnetanjahu #openhouse #regierungsdigitalisierung #kiimalltag #prompttransparenz #kiunddemokratie #digitaleethik #technologiefolgenabschätzung #kiundgesellschaft #europäischekistrategie #digitalesouveränität #politischetransparenz #vertraueninki #sicherheitsrisikenki #kiundmenschenrechte #politischeverantwortung #digitalewende #kiberatung #digitaleverwaltung #kiinregierung #aiethics #governance #zukunftderdemokratie