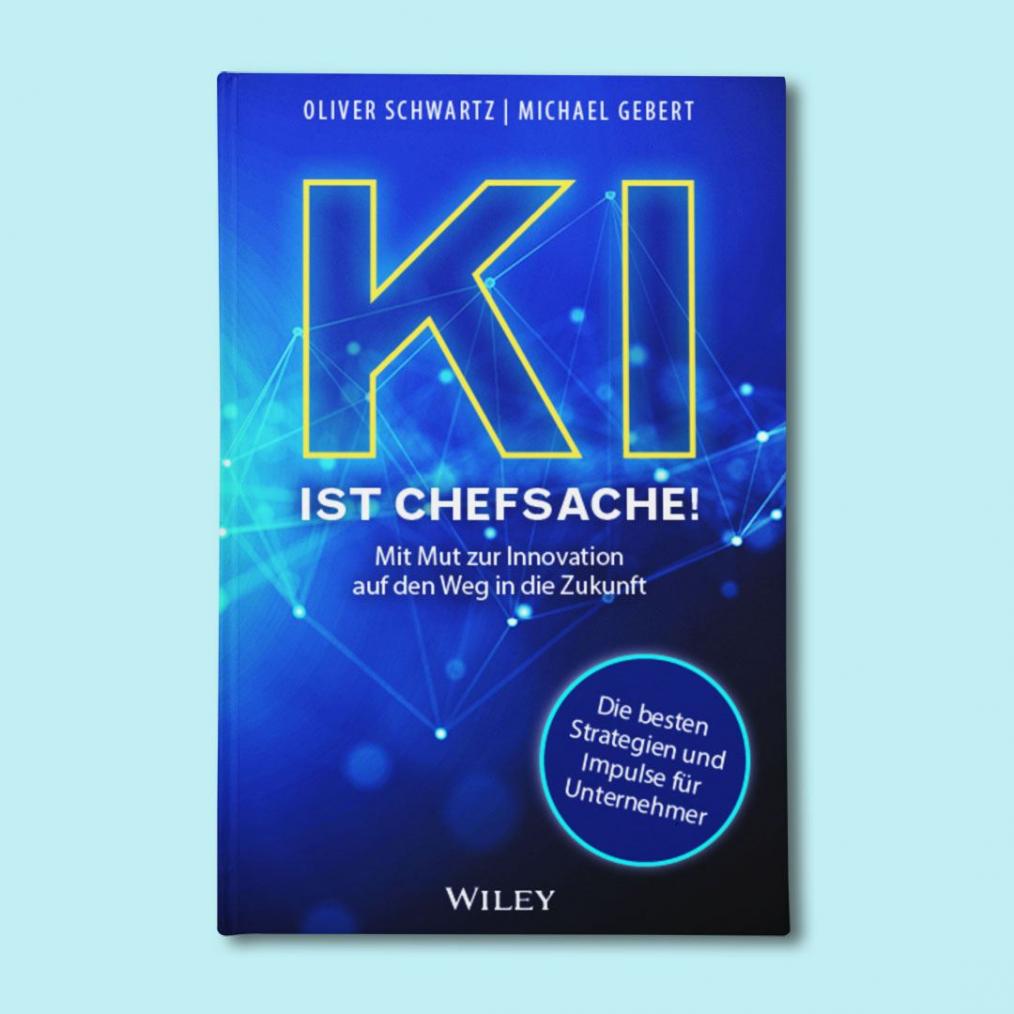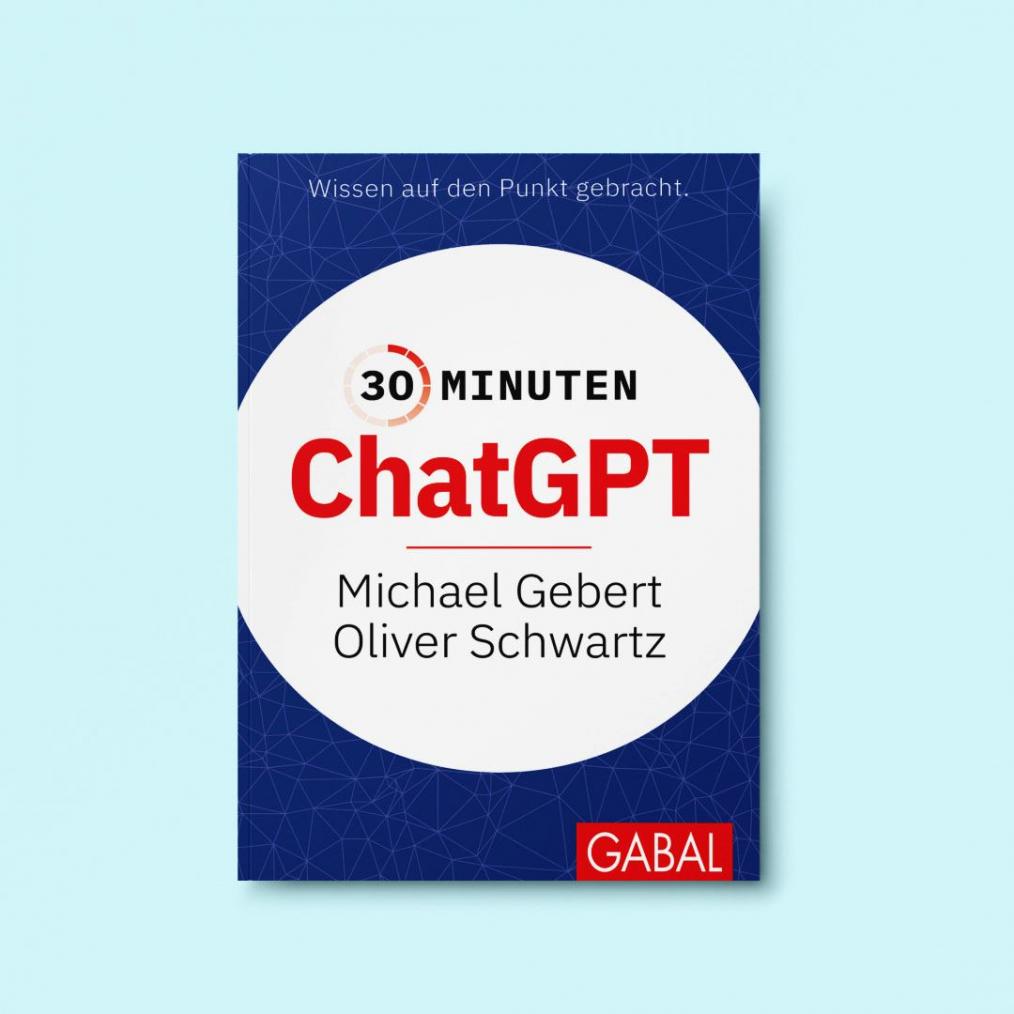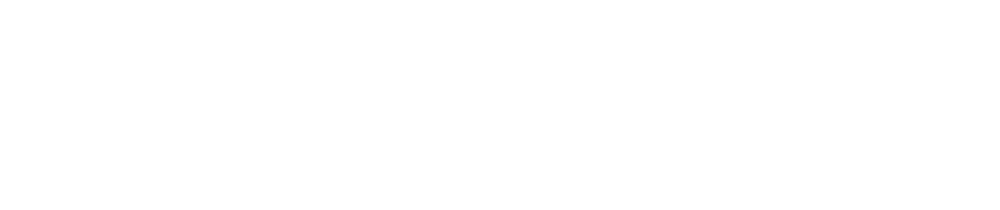Freitag, 28. November 2025 von Rafael Bujotzek
Freitag, 28. November 2025 von Rafael Bujotzek Kindliche Intelligenz in Zeiten von KI
Spielen ist die Superkraft, um die Welt zu verstehen
Die Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt grundlegend – von Texten und Bildern bis hin zu komplexen Prozessen. Unsere Kinder wachsen in einer Epoche voller Möglichkeiten auf, in der KI ein ständiger Begleiter ist, den wir nicht immer vollständig verstehen. Doch welche Rolle spielt Kreativität in diesem Kontext? Wie fördern wir sie bei Kindern und uns selbst?
Spielen, das ist die kindliche Superkraft, mit der schon die Allerkleinsten Neues entdecken und Funktionen erforschen, um die Welt von Anfang an erkunden und zu verstehen. Sie testen Haptik, physikalische Eigenschaften, ja sogar den Geschmack. Sie greifen sich einen Gegenstand und spielen damit herum, bis er langweilig wird. Nur, um sofort den Nächsten und den Nächsten zu probieren. Diejenigen Erwachsenen, die gerade mit Künstlicher Intelligenz die meisten Fortschritte machen, gehen nicht anders vor. Sie probieren aus, scheitern, probieren weiter und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus.
Die gemeinnützige LEGO Foundation, eine dänische Unternehmensstiftung, die sich auf lebenslanges Lernen, Kreativität und Engagement fokussiert, hat eine aktuelle Studie des renommierten britischen Alan Turing Instituts gefördert, die zeigt: Kinder nutzen ebenfalls KI-Tools wie ChatGPT, um kreativ zu sein, Informationen zu finden oder einfach zu spielen. Fast ein Viertel der 8- bis 12-Jährigen hat schon mit generativer KI experimentiert – meist, um Bilder zu gestalten oder Neues zu lernen. Besonders Kinder mit zusätzlichen Lernbedürfnissen profitieren offensichtlich von KI, etwa indem sie ihre Gedanken besser ausdrücken können oder soziale Unterstützung beim Lernen erhalten.
Doch die Studie zeigt außerdem: Eltern und Lehrkräfte sind zwiegespalten. Sie erkennen die Chancen, fürchten aber auch Risiken wie den Verlust kritischer Denkfähigkeit oder den Zugang zu ungeeigneten Inhalten. Viele Kinder bevorzugen für kreative Tätigkeiten nach wie vor analoge Materialien – sie schätzen das haptische Erlebnis, das echte Bauen, das gemeinsame Spiel. Und sie wünschen sich, dass KI so gestaltet wird, dass sie ihre Identität und Vielfalt widerspiegelt, anstatt nur standardisierte Antworten zu liefern.
KI in der Bildung
Obwohl es viele Ansätze für eine schulische Herangehensweise an KI gibt, hat die Welle des ChatGPT-Hausaufgaben-Fastfoods die Klassenzimmer überrollt. Kinder erklären den Erwachsenen die neue Technologie. Dabei waren wir nach der Pandemie doch auf einem guten Weg.
»Ihr werdet später nicht immer einen Taschenrechner dabeihaben«, hieß es früher. Heute kann das Smartphone Aufgaben anhand eines Fotos lösen. Wie zuvor bereits andere Internetquellen macht KI, wie man so sagt, »die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer«. Oder wenn Sie es neutestamentlich mögen: »Denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird genommen.« Man nennt das nach dem biblischen Bezug den Matthäus-Effekt. Wenn man mal ehrlich ist, haben wir wenig vom eingepaukten Wissen heute noch drauf. Wo braucht man die meisten Fakten spontan im Alltag? Vielleicht beim Kneipenquiz oder „Wer wird Millionär“ – und selbst Günther Jauch lässt einem noch den Telefonjoker.
Man könnte genug Freiraum schaffen, um technische Fähigkeiten im Unterricht einzusetzen. „Die Vorstellungskraft ist wichtiger als das Wissen“, das wusste schon Albert Einstein und der hatte bekanntlich eine 4 in Mathe, was aber im Schweizer Schulsystem einer deutschen 3 entspricht. Ich würde anfügen, dass Neugier diese Vorstellungskraft wecken kann.
Während in manchen Ländern die Smartphones, und damit auch die KI, aus der Schule verbannt werden, lohnt sich ein Gedanke, statt Verboten mehr digitale Kompetenz zu schulen. Frühzeitig! Denn wenn wir wollen, dass Kinder sich informieren, politisch bilden und selbstständig werden, wieso sollten wir ihnen das die meiste Zeit des Tages verwehren? Das Problem wird damit nur auf die Abendstunden und aus dem Einflussbereich der Schule geschoben. Man muss doch ohnehin die eine Schule mit der Lupe suchen, die bisher noch keine Leitlinie für den Umgang mit Elektronik hat.
Medienbildung und KI-Wissen gehören meiner Meinung nach fest zu einem umfassenden Bild der heutigen Welt dazu, ohne das deutsche Schülerinnen und Schüler aufgeschmissen und manipulierbar sein werden – übrigens auch für populistische Propaganda! Nun ist Medienbildung in deutschen Schulen zwar ein zentrales Bildungsziel, das jedoch je nach Bundesland und Unterrichtsstätte unterschiedlich umgesetzt wird. Die Vermittlung erfolgt nicht in einem eigenen Schulfach, sondern fachübergreifend und ist eng mit der Digitalisierung des Unterrichts verbunden also abhängig von technischer Ausstattung, IT-Personal und ausreichend Zeit im Lehrplan.
Wo könnte Deutschland in der IT stehen, wenn es intensiver geschult würde? Wie viel persönliches Leid wie Depressionen und Straftaten könnten verhindert werden, wenn frühzeitig Mobbingmethoden und Cyberkriminalität erläutert würden? In jedem Fall müssen schon die Jüngsten lernen, welche Medientricks Spannung erzeugen, mit welchen Methoden man ihnen Produkte aufdrängt und dass KI-generierte Bilder nicht immer der Realität entsprechen. So etwas kann man nicht nebenbei vermitteln, dafür braucht es fachlich kompetente Kräfte.

KI-Symbolbild: Kinder KI-Gipfel. Forderung an die europäischen Staats- und Regierungschefs.
Kinder fordern eine kindgerechte KI-Zukunft
Bei der rasanten Entwicklung, die Künstlicher Intelligenz hinlegt, werden Bedürfnisse und Perspektiven von Kindern schnell vergessen. Doch sie sind nicht nur die Nutzenden von morgen, sondern bereits heute aktiv mit KI-Technologien in Kontakt. Im Rahmen eines Kinder-KI-Gipfels (kurz vor dem der Staats- und Regierungschefs im Frühjahr in Paris) formulierten 8 bis 18-Jährige dieses Manifest:
Hört auf die Kinder!
Berücksichtigt die Erfahrungen und Bedürfnisse von Kindern und setzt Maßnahmen um, die gewährleisten, dass KI und Social Media für Kinder sicher sind.
Formuliert Gesetze, die garantieren, dass KI ethisch entwickelt und genutzt wird.
Beachtet Umweltauswirkungen von KI: Wir wollen, dass sie mit sauberen Energiequellen betrieben wird.
Sorgt für mehr KI-Fortbildungen, einschließlich Leitlinien und Hilfestellungen, damit Menschen besser verstehen, was sie ist, wie sie funktioniert und wie wir sie sicher und angemessen nutzen können.
Verpflichtet Unternehmen zu Transparenz und Ehrlichkeit darüber, wie sie KI einsetzen, und dazu, klar darzulegen, wie KI-Systeme entwickelt wurden.
Verfolgt alle Trainingsdaten, die zur Entwicklung von KI-Modellen verwendet werden, und entfernt voreingenommene und rassistische Daten.
Stellt sicher, dass KI-Systeme sicher vor Hackern und Kriminellen sind.
Gewährleistet, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, von KI zu profitieren.
Erwachsene müssen wieder Spielen lernen
In Ländern wie China oder den USA wird Künstliche Intelligenz schon in die Grundschule gebracht. Der globale Wettkampf um die Vorherrschaft der Meinung und des Systems wird im Kinderzimmer und auf dem Schulhof ausgetragen. Und wo stehen wir dabei?
Das Konzept des Kindergartens ist eine deutsche Erfindung und hat tatsächlich eine Anspielung auf das Hegen und Pflegen von Pflanzen. Vor 185 Jahren kam Friedrich Fröbel die Idee: Spielen als Grundlage der Intelligenz zu etablieren. Kinder sollen spielen und dabei sich und die Welt verstehen lernen. Bis dahin gab es nur sogenannte „Kinderbewahranstalten“, wo Ordnung gelehrt und Nahrung gereicht wurde. Erst acht Jahre nach dem verbitterten Tod des Pädagogikpioniers setzt sich das Konzept durch. Heute ist es ein Welterfolg und “kindergarten“ ist sogar in der englischen und rund 40 anderen Sprachen ein Lehnwort. Ausgerechnet im Heimatland sprechen wir heute von „Kindertagesstätte“ aber das ist eine Petitesse.
Eine Lösung für die erste Begegnung mit der Künstlichen Intelligenz haben wir hierzulande noch nicht gefunden. Dabei wäre ein Sprachassistent mit KI-Fähigkeiten jemand, der die vielen „Warum?“-Fragen geduldig bis zur Erschöpfung beantwortet, der alle Superhelden und Fahrzeuge kennt, der sogar für Konflikte eine diplomatische Lösung findet. Letztlich haben wohl die wenigsten KiTas in Deutschland bisher KI im Einsatz – falls überhaupt vielleicht für Ausmalbilder und Elternbriefe. Haben sie eventuell eine Antwort auf die Gegenfrage?
Längst werden Sorgen und Ängste vor der Künstlichen Intelligenz laut und es ist wie eine narzisstische Kränkung im Freud’schen Sinne, dass wir Menschen nach unserem Selbstverständnis nicht mehr die alleinigen Intelligenzen sein sollen. Was unterscheidet uns noch, wenn ein Computer denken und alles machen kann, vielleicht sogar besser als wir kreativ und tüchtig ist? Wir dürfen dabei nicht vergessen, wie wichtig das „echte“ Spielen, das Bauen mit den eigenen Händen und das kreative Miteinander funktionieren. Unsere sozialen Fähigkeiten, die Gemeinsamkeit, das Gespräch, die Einsicht, zeichnen uns aus und werden wichtiger denn je. Auch das „Um-die-Ecke-denken“, das eine Maschine nicht so gut kann wie ein Mensch, müssen wir weiter am Leben halten. Was im Kindergarten noch selbstverständlich ist, wird in der Schule von heute schon vernachlässigt und im Erwachsenenalter verkümmert es meist, obwohl es doch leicht zu wecken wäre.
Seit Kindertagen Liebe zu den bunten Bausteinen
Schon als Kind liebte ich die bunten LEGO-Steine. Stundenlang saß ich auf dem Teppich, baute Häuser, Fahrzeuge und Fantasiewelten – Stein auf Stein, immer wieder neu, immer wieder anders. Als 1984 Geborener bin ich in einer Welt ohne Internet aufgewachsen, ohne Smartphone und erst recht ohne Künstliche Intelligenz. Ganz anders die Kinder, die jetzt in die Schule kommen. Sie kennen keine Welt ohne KI. Für sie ist es völlig selbstverständlich, dass der virtuelle Assistent klüger, schlagfertiger und jederzeit ansprechbar ist.
Neulich habe ich meine Faszination auf eine besondere Weise wiederentdeckt – bei einer Reise ins Legoland im bayerischen Günzburg an der Grenze zu Baden-Württemberg. Dort spürt man schon beim Betreten: Alles ist LEGO, die Gebäude, die Figuren. Es ist diese Liebe zum Detail, die diesen trotz seiner rund 70 Fahrgeschäfte von anderen Freizeitparks unterscheidet. In einer nachgebauten Fabrik kann man seltene Steine nachkaufen, in den Themenwelten wie City, Ninjago, Mythica oder dem Land der Ritter taucht man in fantastische Abenteuer ein, sogar in ein Sea-Life-Aquarium mit echten Fischen. Die Wartebereiche vor den Attraktionen sind mit Baustationen ausgestattet, damit Kinder spielen können, während die Eltern anstehen. Besonders beeindruckt hat mich die LEGO-Fahrschule: Hier können Kinder ihren eigenen „Führerschein“ machen – inklusive realitätsgetreuem Parcours mit Schildern und Ampeln in Elektrofahrzeugen, die scheinbar selbst aus größeren Legosteinen konstruiert sind. Das ist gleichzeitig spielerisch vermittelte Verantwortung mit Verkehrsregeln und gegenseitiger Achtsamkeit.
Überall begegnet man der Magie, die nur LEGO erschaffen kann: Die Möglichkeit, aus scheinbar einfachen Steinen ganze Welten zu bauen – und dabei die eigenen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Wozu das führen kann, zeigt das „Miniland“, in dem 23 Millionen LEGO-Steine zu Sehenswürdigkeiten aus aller Welt verbaut wurden: der Markusplatz in Venedig liegt nahe am Hamburger Hafen und schräg gegenüber steht die Frankfurter Skyline – alles im Maßstab 1:20 und aus bunten Klemmbausteinen.
Während ich durch den Park schlendere, wird mir deutlich: LEGO ist weit mehr als ein Spielzeug. Es ist ein Werkzeug, das Kreativität, Problemlösungskompetenz und räumliches Denken fördert – Eigenschaften, die in unserer zunehmend von Künstlicher Intelligenz geprägten Welt wichtiger denn je sind. Denn auch KI fordert uns ab, dass wir uns orientieren und die Ergebnisse einordnen können.
Welche Fähigkeiten brauchen Menschen in einer Welt mit KI?
Alle Welt redet von Künstlicher Intelligenz. Es ist das Thema des Jahrzehnts, wenn das mal genügt. Wer neugierig und aufnahmebereit ist, bleibt beweglich, kann auf Unsicherheiten und Marktschwankungen reagieren und mit Fehlern und Rückschlägen klarkommen. Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, gegenüber äußeren und inneren Schwierigkeiten ist mehr und mehr Thema.
Die Vorbereitung fängt bereits im Kindergartenalter an: Mehr Sandkasten und Interaktion mit Gleichaltrigen und weniger Medienkonsum – diese Binsenweisheit ist aktueller denn je. Und das erzählt Ihnen jemand, der fast seine ganze Bildung aus dem Fernsehprogramm der frühen 1990er-Jahre gezogen hat!
Vertrauen und Skepsis sind gute Antagonisten, um nicht völlig abzuschalten, aber die eigene Abhängigkeit von der Maschine stets in Frage stellen zu können. Und besonders eine kritische Medienkompetenz, die Fakes und Verlockungen entlarvt, ist wichtiger denn je.
Christopher Pissarides, Nobelpreisträger und Wirtschaftsprofessor der „London School of Economics“, warnt wegen KI davor, dass ein MINT-Studium leicht an Bedeutung verlieren kann. Viele analytische Aufgaben würden automatisiert. Er ist überzeugt, dass in Zukunft empathische und kreative Fähigkeiten in Bereichen wie Kommunikation, Kundenservice und Gesundheitsfürsorge an Bedeutung gewinnen, da sie weniger leicht ersetzt werden können.
Es können in Zukunft also tatsächlich einige Berufsbilder wegfallen. Gerade MINT-Berufe dürften sich auf kreative und empathische Aspekte verlagern, die schwer automatisierbar sind. Auch die Schulbildung sollte anders ablaufen. Das heißt nicht, dass Geschichte oder Mathematik komplett nutzlos werden. Vielleicht ist aber die eine oder andere Jahreszahl oder Formel zu vernachlässigen und es ist nicht zwangsläufig notwendig, einen Abschluss nach mehreren Semestern zu erreichen, um in einem Beruf Fuß zu fassen.
Der vielseitige Entertainer Stefan Raab, der nach einer Metzgerlehre gefolgt von fünf Semestern Jura-Studium in die Medienbranche einstieg und in seinen Shows immer wieder den Wettkampf in den wahnwitzigsten Disziplinen sucht, betont, es sei besser, viele Dinge ein wenig zu beherrschen, als eine Sache sehr gut und dafür nichts anderes.
So manche Content Creators wissen, wovon die Rede ist. Es ist ein Plädoyer gegen das „Fachidiotentum“ und die Einbahnstraße der Bildung. Ein universaler Gelehrter im antiken Sinne. Raab brachte sich schon als Kind selbst Musikinstrumente bei.
Vielseitigkeit und Forschergeist sind in einer von KI geprägten Welt ein strategischer Vorteil und Kinder sollten ermutigt werden, unterschiedlichste Fähigkeiten zu entwickeln.
■
Unser Gastautor

Rafael Bujotzek
Rafael Bujotzek, Jahrgang 1984, ist studierter Onlinejournalist, Unternehmer und Nerd. Seine Bücher »Content Creation mit Künstlicher Intelligenz für Dummies« und »KI oder nie! Digitale Transformation als Chance« sind im WILEY Verlag erschienen.
Im Laufe seiner Karriere hat er für namhafte internationale Medienhäuser gearbeitet und wird als IT-Experte und Berater konsultiert. Er moderiert Veranstaltungen, Preisverleihungen und Diskussionen, ist Redakteur, Filmkritiker und Synchronsprecher. Darüber hinaus lehrt er an Universitäten und Hochschulen.