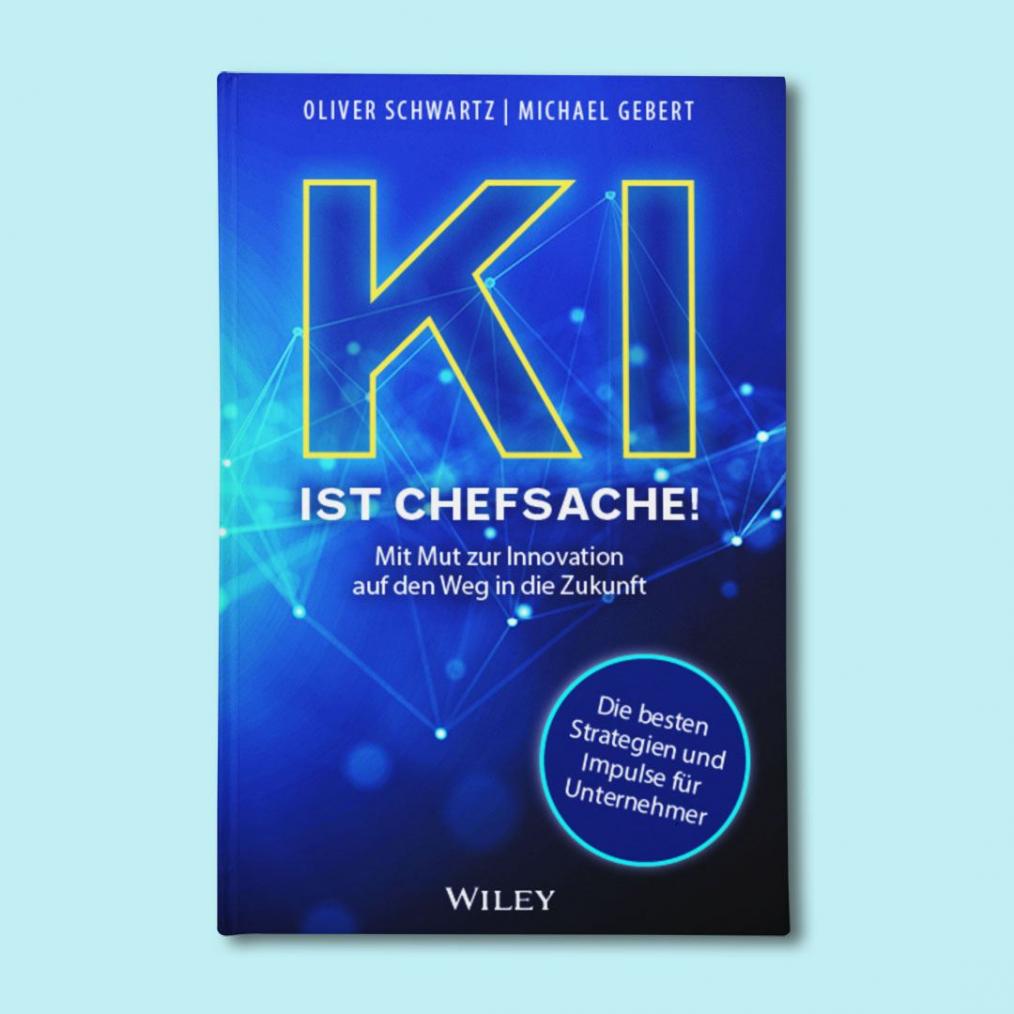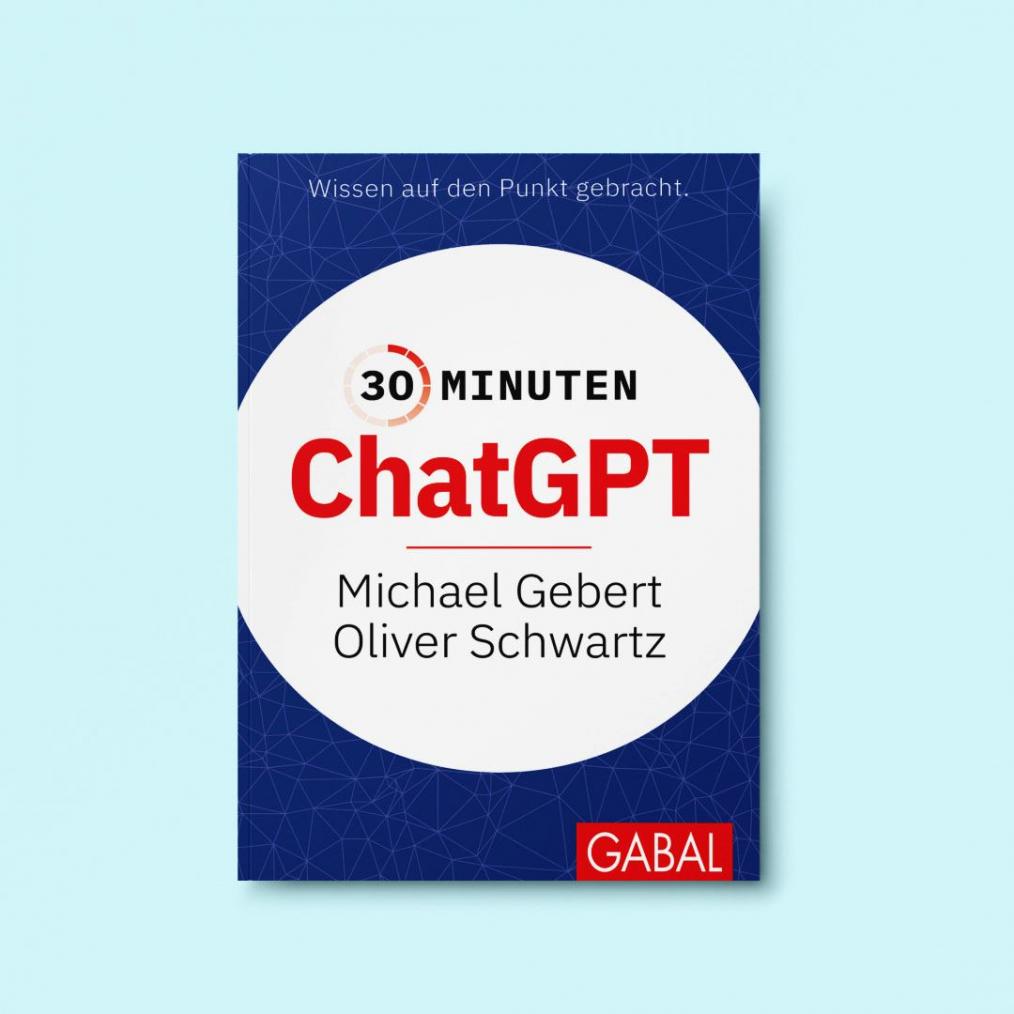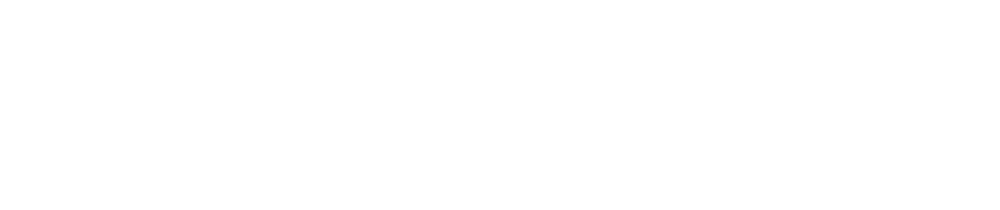Dienstag, 23. September 2025 von Oliver Schwartz
Dienstag, 23. September 2025 von Oliver Schwartz Der Streit um Suno und die Vorwürfe der Musikindustrie
Wie legal ist Musik von KI-Generatoren?
Es kommt nicht völlig unerwartet und erschüttert doch einen beliebten Teil der KI-Industrie: Die großen Plattenlabels Universal, Sony und Warner haben ihre Klageschrift gegen den amerikanischen KI-Musikdienst Suno verschärft. Der Vorwurf ist nicht nur der unautorisierte Einsatz urheberrechtlich geschützter Musik für das Training der Algorithmen, sondern auch ein mutmaßlicher Verstoß gegen das US-amerikanische Urheberrechtsgesetz, genauer gesagt gegen den Digital Millennium Copyright Act. Damit steht erstmals ein prominenter Anbieter von KI-Musik im Zentrum einer juristischen Auseinandersetzung, die weit über den Einzelfall hinausweist. Es geht um die Frage, ob die Art und Weise, wie solche Systeme lernen, überhaupt legal ist – und welche Folgen dies für Anbieter, Künstler und Nutzer haben könnte.
Die Klage richtet sich konkret gegen die Praxis, Trainingsdaten aus YouTube zu extrahieren. Nach Darstellung der Musikindustrie hat Suno nicht nur ohne Genehmigung Songs kopiert, sondern dabei auch eine technische Schutzmaßnahme umgangen, die sogenannte „rolling cipher“ von YouTube. Genau dieses Umgehen ist nach DMCA §1201 explizit untersagt. Während Suno selbst weiterhin auf Fair-Use -nach US-Urheberrecht- pocht und betont, die generierten Songs seien originär und nicht mit bestehenden Werken identisch, verlangen die Labels Schadensersatz in potenziell Milliardenhöhe. Denn pro nachgewiesenem Verstoß können bis zu 150.000 Dollar geltend gemacht werden, hinzu kommen weitere Strafen für jede Umgehungshandlung. Es ist ein Schlagabtausch, der juristisch hochkomplex, wirtschaftlich folgenreich und politisch brisant ist.
Doch ist damit der KI-Musikgenerator an sich ein illegales Werkzeug und was bedeutet das für uns Nutzer? Die kurze Antwort lautet „Nein“ – aber gerade hier lohnt sich eine differenzierte Betrachtung. Der Kern des aktuellen Streits liegt nicht in der Technologie selbst, sondern im Umgang mit den Daten, die zum Training eingesetzt werden. KI-Systeme wie Suno, Udio oder auch die offenen Forschungsmodelle von Meta und Google funktionieren auf ähnliche Weise: Sie werden mit riesigen Mengen von Musik gefüttert, um Muster in Rhythmus, Harmonie, Klangfarbe und Stilistik zu lernen. Erst daraus entsteht die Fähigkeit, auf Knopfdruck neue Musikstücke zu erzeugen, wenn ein Nutzer ein Textprompt eingibt – etwa „Pop-Song im Stil der 80er mit Gitarrensolo“. Entscheidend ist jedoch, welche Daten verwendet werden, und ob deren Nutzung rechtlich abgesichert ist.
Einige Anbieter betonen genau diesen Punkt. Stability AI etwa hat für sein Produkt Stable Audio einen Vertrag mit dem Musikarchiv AudioSparx abgeschlossen. Meta wiederum verweist darauf, für das eigene Forschungsmodell MusicGen nur lizenzierte Daten von Shutterstock oder Pond5 genutzt zu haben. Google experimentiert mit MusicFX und Lyria, zwei KI-Systemen, die nicht nur Musik generieren, sondern mit dem Wasserzeichen-Tool SynthID auch eine technische Kennzeichnung einführen sollen, um KI-generierte Inhalte erkennbar zu machen. Diese Ansätze unterscheiden sich fundamental von jenen Firmen, die wenig Transparenz zeigen oder die Herkunft ihrer Trainingsdaten im Dunkeln lassen.
Im Fall von Suno ist es genau diese Intransparenz, die die Branche hellhörig gemacht hat. Schon seit Monaten kursierten Berichte, dass die Firma nicht klar offengelegt habe, wie und mit welchen Daten die Algorithmen trainiert wurden. Investigative Recherchen von Branchenverbänden deuteten darauf hin, dass YouTube in großem Stil als Quelle gedient haben könnte. Die nun nachgereichte Klageschrift der RIAA scheint diesen Verdacht zu stützen. Damit ist Suno nicht mehr nur ein Experimentierfeld für ambitionierte Entwickler, sondern ein Präzedenzfall, der die Frage aufwirft: Kann eine KI Musik generieren, ohne zuvor urheberrechtlich geschützte Werke legal oder illegal zu nutzen?
Ist dieser Song legal?
Gute Frage. In erste Linie: Der Text stammt vom Autor dieses Artikels und erfüllt damit die urheberrechtliche Schöpfungshöhe. Aber was ist mit der Musik? Sind die Stimmen durch rechtswidriges Training entstanden? Gute Frage! Die Antwort ist nicht pauschal möglich. Unabhängig davon: Die Generierung eines KI-Songs ist faszinierend und das Ergebnis überzeugend!
Darf ich die Musik, die mir Suno oder andere Dienste „komponieren“, überhaupt veröffentlichen?
Die juristische Gemengelage ist komplex. In den USA gilt, dass die Umgehung technischer Schutzmaßnahmen strafbar ist – selbst dann, wenn das spätere Ergebnis nicht direkt ein Plagiat darstellt. Entscheidend ist also nicht, ob ein KI-generierter Song einem bekannten Titel gleicht, sondern ob die Datenbeschaffung an sich rechtmäßig war. In Europa wiederum ist die Lage etwas anders: Hier existieren in der EU-Urheberrechtsrichtlinie sogenannte Text- und Data-Mining-Ausnahmen, die es erlauben, auch geschützte Werke zu Trainingszwecken zu nutzen – solange Rechteinhaber nicht aktiv widersprechen. Labels und Verlage haben dafür inzwischen sogenannte Opt-out-Erklärungen veröffentlicht. Doch auch in Europa bleibt die Frage ungeklärt, ob diese Ausnahmen tatsächlich auf das Training von KI-Modellen in großem Stil anwendbar sind. Erste Gerichtsverfahren, etwa in Hamburg, deuten an, dass es darauf entscheidend ankommen wird, wie transparent und verhältnismäßig Anbieter vorgehen. Und natürlich immer, ob die KI-Musik am Ende nicht nur ähnlich klingt, sondern als Plagiat einzuordnen ist.
Für Nutzerinnen und Nutzer stellt sich währenddessen eine ganz andere Frage: Darf ich die Musik, die mir Suno oder andere Dienste „komponieren“, überhaupt veröffentlichen? Grundsätzlich gilt: Das Nutzen solcher Tools ist nicht per se illegal. Wer einen Song generiert, macht sich in der Regel nicht strafbar. Probleme entstehen aber dann, wenn das Ergebnis zu nah an einem bestehenden Werk liegt oder wenn Stimmen von Künstlerinnen und Künstlern imitiert werden, ohne dass deren Zustimmung vorliegt. Genau hier setzen Plattformrichtlinien an. YouTube etwa verlangt inzwischen, dass realistisch klingende synthetische Inhalte als „altered or synthetic“ gekennzeichnet werden. Spotify erlaubt KI-Musik, geht aber gegen täuschende Imitationen oder massenhafte Spam-Inhalte vor. Hinzu kommt, dass rein KI-generierte Werke in den USA bislang nicht urheberrechtlich geschützt sind – sie gelten mangels menschlicher Schöpfungshöhe als gemeinfrei. Das bedeutet: Wer auf eine exklusive Vermarktung setzt, könnte leer ausgehen. Dies ist auch ein Problem für Unternehmen, die zum Beispiel einen Company-Song oder Werbe-Musik mit Hilfe der KI generieren wollen.
Dass die juristischen Risiken längst nicht nur theoretischer Natur sind, zeigt die parallele Klage der Labels gegen Udio, einen weiteren US-Anbieter. Auch hier lautet der Vorwurf, geschützte Werke ohne Erlaubnis genutzt zu haben. Die Branche macht also ernst. Und es ist nicht auszuschließen, dass weitere Anbieter ins Visier geraten. Bislang hat sich allerdings noch kein Verfahren gegen kleinere Plattformen wie Songer.co ergeben. Dieser Anbieter wirbt damit, dass Nutzer „ihre Songs besitzen“ und dass die Musik originär sei. Doch Transparenz über die Trainingsdaten fehlt auch hier. Klagen gibt es bislang nicht, doch gerade die Erfahrung mit Suno lehrt: Solange die Datenbasis im Dunkeln bleibt, bleibt auch das Risiko bestehen.
Technisch gesehen unterscheiden sich die Systeme kaum. Ob Diffusionsmodelle oder autoregressive Architekturen, fast alle modernen KI-Musikgeneratoren arbeiten mit Embeddings, die Klang und Rhythmus in mathematische Muster übersetzen. Die Unterschiede liegen vor allem in der Datenbasis – und genau dort entscheidet sich die rechtliche Bewertung. Wer Lizenzen kauft und sauber dokumentiert, kann weitgehend risikofrei arbeiten. Wer auf Grauzonen setzt, läuft Gefahr, ins Fadenkreuz zu geraten. Für die Musikwelt ist das mehr als nur ein Streit um Daten. Es geht um die Frage, wie kreativ Schöpfung in Zeiten von Algorithmen neu definiert wird. Ist ein Song, den ein KI-Modell nach Millionen von Trainingsbeispielen erzeugt, ein eigenständiges Werk? Oder ist er am Ende doch nur eine statistische Neuberechnung des Bestehenden? Künstler und Komponisten fürchten nicht nur um ihre Einkünfte, sondern auch um die kulturelle Bedeutung ihres Schaffens. Wenn Musik auf Knopfdruck generierbar wird, verliert sie dann ihren Wert? Oder eröffnet sich dadurch eine neue Spielwiese kreativer Möglichkeiten?
Die Klage gegen Suno ist deshalb mehr als nur ein Rechtsstreit zwischen Konzernen. Sie ist ein Prüfstein für die Regulierung der Künstlichen Intelligenz. Der Ausgang wird nicht nur über die Zukunft einzelner Start-ups entscheiden, sondern über die Spielräume einer ganzen Branche. Schon jetzt ist klar: Weder werden sich die Algorithmen zurückdrehen lassen, noch werden die Rechteinhaber kampflos zuschauen. Die kommenden Monate könnten zum Lackmustest werden, ob es gelingt, ein Modell zu finden, das Innovation ermöglicht, ohne Urheberrechte zu verletzen. Die Musikindustrie ist bekannt dafür, sich vehement gegen neue Technologien zu wehren – man denke an die Napster-Ära oder die Kämpfe gegen YouTube selbst.
Doch im Unterschied zu damals geht es nun nicht um einzelne Kopien von Songs, sondern um die Grundlage dessen, wie Maschinen lernen. Das macht die Debatte so grundlegend. Und es macht sie so schwierig. Denn anders als beim illegalen Download lässt sich nicht einfach auf „alles verboten“ setzen. Das Training von KI ist technisch unvermeidbar auf große Datenmengen angewiesen. Verbietet man dies gänzlich, legt man eine ganze Branche lahm. Erlaubt man es schrankenlos, unterminiert man die Rechte der Künstler. Der Balanceakt dazwischen ist noch nicht gefunden.
Für Marktbeobachter öffnet sich damit ein weites Feld an Fragestellungen. Welche Anbieter arbeiten tatsächlich mit Lizenzen, und wer nicht? Welche rechtlichen Strategien verfolgen die Labels? Wie positionieren sich Plattformen wie YouTube oder Spotify? Und welche Rechte haben Nutzer, die ihre KI-Songs hochladen? Die Debatte ist erst am Anfang, die Verfahren ziehen sich typischerweise über Jahre. Doch eines ist jetzt schon klar: Die Klage gegen Suno könnte zum Wendepunkt werden, an dem sich entscheidet, wie viel Freiheit künstliche Intelligenz in der Musik künftig haben darf – und welchen Preis, zu Lasten von Künstlerinnen und Künstlern, wir dafür zu zahlen bereit sind. ▪
#suno #udoi #ki #künstlicheintelligenz #kimusik #aigenmusic #generativeai #musicgen #stableaudio #musicfx #lyria #synthid #google #meta #stabilityai #spotify #youtube #audiogen #audiogenai #digitalkunst #digitalmusic #musikindustrie #universal #sony #warner #riaa #copyright #urheberrecht #dmca #fairuse #datamining #trainingdata #lizenzierung #audiostreaming #musikrecht #musikkultur #innovation #regulierung #kiethik