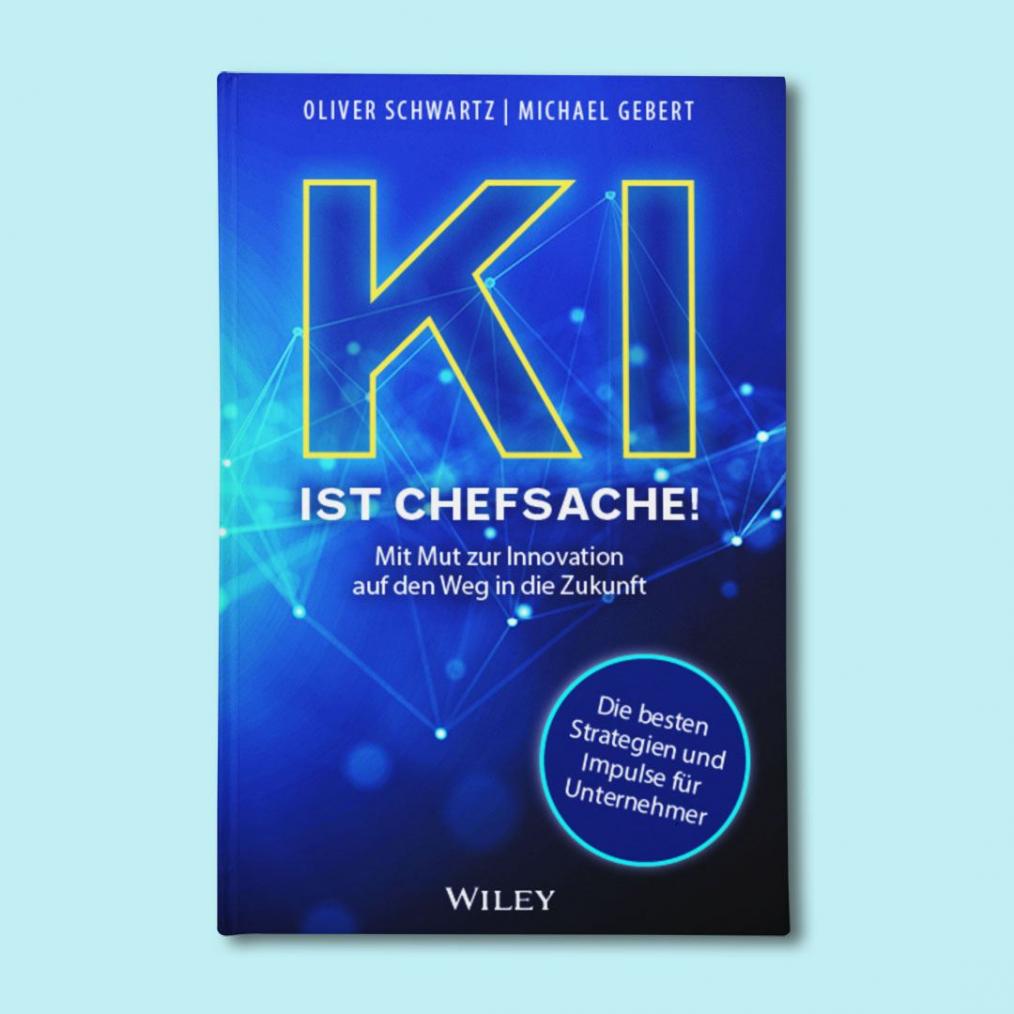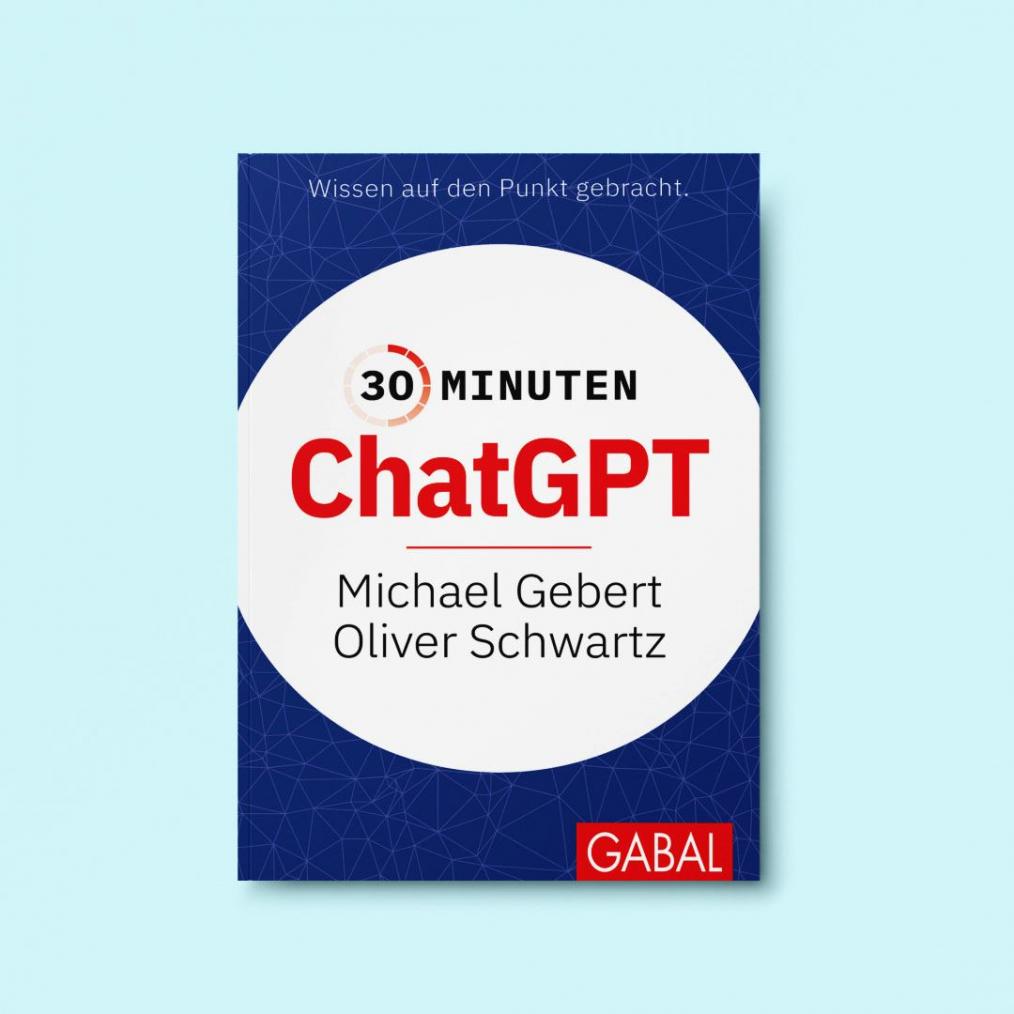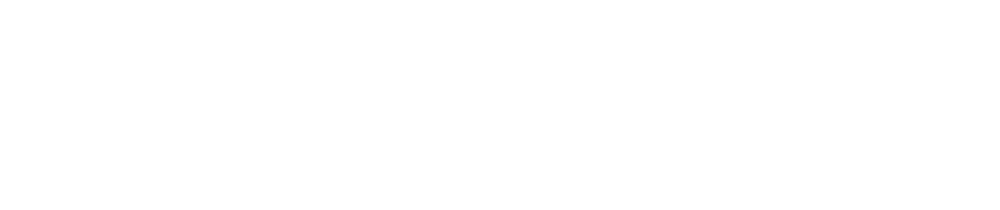Freitag, 7. November 2025 von Oliver Schwartz
Freitag, 7. November 2025 von Oliver Schwartz Robotik, Maschinensteuerung und KI arbeiten Hand in Hand
Dark Factories - Vollautomatische Fabriken im Trend
Die „Dark Factory“ verzichtet – wörtlich und sinnbildlich – auf Licht, weil dort kaum noch jemand arbeitet, der es bräuchte. Roboterarme, fahrerlose Transportsysteme, autonome Zellen und Software-Orchestrierung übernehmen die Arbeit; Menschen greifen nur noch aus der Ferne ein. Hinter dem Schlagwort steht mehr als eine technische Spielerei. Es ist ein tiefgreifender Strukturwandel, der ökonomische Logik, Energieverbrauch, Arbeitsorganisation und Regulierung gleichermaßen berührt. Was davon heute Realität ist, wo die Grenzen liegen, welche Rolle Künstliche Intelligenz spielt und was das für Standorte in Deutschland bedeutet, zeigt ein Blick in jene Produktionsstätten, die bereits konsequent automatisiert haben – und in die Normen und Kostenrechnungen, die diesen Umbau ermöglichen und begrenzen.
Der Begriff „Dark Factory“ stammt aus der Industrieautomatisierung und beschreibt Fertigungsstätten, die weitgehend ohne menschliche Präsenz auskommen, sodass Beleuchtung, Klimatisierung und andere auf das Wohlbefinden von Beschäftigten ausgerichtete Infrastrukturen entbehrlich werden. Technisch ist das Resultat eine Gesamtarchitektur aus vernetzten Maschinen, Sensorik und Steuerungen, die in Echtzeit koordiniert werden und autonom Entscheidungen über Reihenfolgen, Parameter und Qualität treffen. In der Praxis variiert der Grad der Dunkelheit: Manche Anlagen laufen nachts ohne Personal, tagsüber jedoch mit Bedienern; andere sind nahezu rund um die Uhr menschenfrei. Die Automationsbranche verwendet dafür seit Jahren den Begriff „lights-out manufacturing“; einschlägige Leitfäden definieren ihn als Betrieb „mit wenig oder keiner menschlichen Intervention“, getragen von Robotik, Maschinensteuerungen, datengetriebenen Softwareschichten und zunehmend von KI-Modellen, die Anomalien erkennen, Wartung voraussagen oder Prozesse optimieren.
Ist das die Ausnahme oder ein Trend? Der nüchterne Befund: Vollständig „dunkle“ Werke sind bis heute seltene Leuchttürme; der Trend geht jedoch eindeutig in Richtung höherer Autonomiegrade über immer mehr Branchen hinweg. Sichtbar wird das in der Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums, das Vorreiterwerke auszeichnet, die digitale Technologien skalieren – viele davon kommen inzwischen ohne ständige Präsenz von Mitarbeitenden in der Linie aus, zumindest in Teilprozessen. Jüngste Kohorten fügen Jahr für Jahr zweistellige Zahlen von Standorten hinzu, mit Schwerpunkten in China, aber auch in Europa und Nordamerika; Foxconn in Shenzhen etwa wurde als „Sustainability Lighthouse“ gewürdigt, weil es KI, IoT und Analytik entlang der Linie skaliert und damit Effizienz- und Emissionsziele verbindet. Das ist kein Etikett „Dark Factory“, aber der Richtungspfeil ist eindeutig: Autonomie wird zum industriellen Standard, wo Produkte, Volumina und Prozesse es zulassen.
Welche Rolle spielt KI bei den Dark Factories?
Die bekanntesten Beispiele zeigen, wie früh das Konzept Wurzeln geschlagen hat – und wie sehr die technische Reife zunimmt. Ikonisch ist FANUC in Japan: Der Roboterhersteller lässt seit den frühen 2000ern Roboter von Robotern bauen und betreibt Schichten, die vollständig unbeaufsichtigt laufen; Branchenberichte nennen 50 Roboter pro 24-Stunden-Schicht und Laufzeiten von bis zu 30 Tagen am Stück ohne menschliches Eingreifen.
Der Ansatz ist mehr als Marketing: FANUC koppelt Bearbeitungszentren, Prüfen und Materialfluss so, dass der Mensch aus dem Takt genommen wird – und die Fabrik damit buchstäblich „lichtlos“ fahren kann.
In Europa wurde 2012 die Philips-Rasiereraproduktion im niederländischen Drachten zum Referenzfall. Medienberichte und Fachartikel beschrieben Linien mit rund 128 Robotern und einer nur noch einstelligen Zahl von Mitarbeitenden für Qualitätssicherung und Aufsicht. Vollends menschenleer war die Halle nicht, aber der Kern des Konzeptes – vollständig automatische Montage, Zuführung und Prüfung – war früh realisiert und hielt über Jahre.
Die jüngsten Vorstöße kommen aus der Elektronikfertigung. Foxconn Industrial Internet betreibt in Shenzhen eine „lights-off“ Fertigung für Smartphone-Komponenten, die der WEF als Leuchtturm klassifiziert; die Linie arbeitet mit maschinellem Lernen für Auto-Optimierung, zustandsbasierter Wartung und Echtzeit-Monitoring. Effizienzgewinne von 30 Prozent und kürzere Bestandszyklen nennt die Fallstudie – ein Indikator dafür, warum sich die Kapitalrechnung für solche Konzepte verdichtet, gerade bei hohem Volumen und geringer Produktvarianz.
Die technologische Basis einer solchen Fabrik ist nach wie vor klassische Automatisierung: Maschinen- und Anlagensteuerungen, Bewegungs- und Antriebstechnik, industrielles Ethernet, Safety-Systeme und ein Manufacturing Execution System, das Aufträge, Material und Qualitätsdaten steuert. Darüber liegt eine digitale Ebene, die Prozessdaten aus Sensorik – Kraft, Temperatur, Vibration, Bilddaten – in Echtzeit erfasst und auswertet. Roboter und autonome Transportsysteme übernehmen Handling und Transport, automatische Prüfsysteme kontrollieren Maß, Oberfläche und Funktion, häufig per Machine Vision.
Die Orchestrierung erfolgt über eine Art „Leitsystem der Leitsysteme“: Das MES spricht mit Werkzeugmaschinen, Robotern und Prüfanlagen, optimiert Reihenfolgen und stößt Qualitätsreaktionen an. Wo Menschen nicht ständig präsent sind, wird Redundanz zentral: Mehrfachsensorik, selbstheilende Netzwerke, zustandsorientierte Wartung und Remote-Zugriff über gesicherte Leitstände sind Pflicht. In hochautomatisierten Halbleiterfabriken ist diese Architektur seit Jahren Standard; in diskreter Montage holen andere Branchen auf.
Die Frage bleibt: Welche Rolle spielt KI – und wo reicht Sensorik plus Steuerungstechnik aus? Derzeit ist die Antwort noch klar: Der technologische Kern bleibt die deterministische Automatisierung, die Takte hält, Bewegungen ausführt und Sicherheitszustände erzwingt. KI kommt dort ins Spiel, wo Komplexität, Varianz oder Störanfälligkeit die Grenzen klassischer Regelung erreichen. Typische Einsatzfälle sind vorausschauende Wartung auf Basis von Schwingungs- und Prozessdaten, Bildverarbeitung zur Defekterkennung, adaptive Prozessführung bei schwankenden Materialien und die Optimierung von Reihenfolgen unter Unsicherheit.
Studien und Praxisberichte zeigen zweistellige Verbesserungen – weniger Stillstand, geringere Ausschussquoten, bessere Overall Equipment Effectiveness –, wobei die größten Effekte bislang aus „analytischer“ KI stammen, während generative KI in der Fertigung eher in Planung, Dokumentation und Assistenzsysteme Einzug hält. Entscheidend: Eine Dark Factory braucht nicht „viel KI“, sie braucht „genau die richtige KI“ an den Stellen, wo deterministische Logik zu starr wäre.
Der Blick auf europäische Vorzeigestandorte belegt den Trend zur softwaredefinierten Produktion, auch wenn dort meist nicht vollständig „dunkel“ gearbeitet wird. Siemens’ Elektronikwerke – das historische Amberg-Werk und das jüngere Schwesterwerk in Erlangen – gelten als Benchmark für digitale Fabriken: Produktvarianz bis in vierstellige SKU-Zahlen, Taktzeiten im Sekundenbereich, harte Qualitätsziele bei minimaler Fläche. Offizielle Darstellungen verweisen auf die konsequente Nutzung von Digital Twins, hunderter KI-Modelle und einer skalierbaren IT-Architektur; die Werke sind Teil des WEF-Netzwerks und zeigen, dass eine europäische Antwort auf hochautomatisierte Fertigung möglich ist – ohne zwingend völlig menschenleere Hallen zu brauchen.
Auch in Deutschland treibt die Halbleiterfertigung die Autonomie voran. Die Bosch-Waferfab in Dresden produziert auf 300-mm-Wafersubstraten in hochreinen Umgebungen mit AGVs, automatischem Handling und digitaler Optimierung; die Linien sind nicht „dunkel“, aber in entscheidenden Teilprozessen menschenfrei, weil das Produkt – Chips auf Silizium – jede Kontamination und jeden Vibrationseintrag abstraft. Vollautomatisierung ist hier Betriebsbedingung. Die kontinuierliche Optimierung stützt sich auf datengetriebene Regelung und – wo sinnvoll – KI-gestützte Vorhersagen. Für Deutschland ist das zentral: Hier entstehen Fähigkeiten, die sich auf andere Branchen übertragen lassen, von der Medizintechnik bis zur Leistungselektronik für E-Mobilität.
Blaupause für den KI-Umbau der Unternehmen?
Wirtschaftlich rechnet sich die Dunkelheit, wenn drei Achsen zusammenkommen: hohe Auslastung, beherrschte Varianz und verlässliche Qualität. Erstens sinken Stückkosten, weil 24/7-Betrieb ohne Schichtzulagen möglich wird und Personalstunden aus der Linie verschwinden. Zweitens sparen Werke Energie, wenn sie Beleuchtung, Heizung oder Kühlung auf ein Maschinenniveau herunterfahren; der Effekt ist produkt- und prozessabhängig, aber gerade in großen Hallen materiell. Drittens verkürzen sich Durchlaufzeiten und Bestände, weil automatisierte Übergaben Puffer abbauen. Der WEF-Case von Foxconn quantifiziert das: 30 Prozent Effizienzplus und 15 Prozent kürzere Bestandszyklen durch skalierte 4IR-Technologien.
Auf der Kostenseite stehen hohe Anfangsinvestitionen, Integrations- und Anlaufkosten, die sich nur bei längerer Produktstabilität amortisieren. Ein häufiger Irrtum: Dark Factories seien vor allem ein Lohnthema. Tatsächlich dominieren Kapitalkosten und die Fähigkeit, mit Komplexität umzugehen – das erklärt, warum Elektronik, Halbleiter und Teile der Konsumgütermontage vorangehen, während hochvariable Manufakturen langsamer folgen.
Typische Risiken sind technisch wie organisatorisch. Autonom laufende Linien erhöhen die Anforderungen an Safety und Security. Roboternormen wie EN ISO 10218 und ISO/TS 15066 definieren Sicherheitsanforderungen, insbesondere wenn Menschen kollaborativ mit Robotern arbeiten; in „dark“ betriebenen Zellen verlagert sich der Schwerpunkt auf trennende Schutzeinrichtungen, Not-Halt-Konzepte, Zustandsüberwachung und sichere Fernwartung.
Gleichzeitig stellt die EU die rechtliche Basis neu auf: Die Europäische Maschinenverordnung 2023/1230 ersetzt die Maschinenrichtlinie und gilt ab 20. Januar 2027 verbindlich – mit bereits laufenden Regelungen, etwa zur Marktüberwachung. Für Betreiber in Europa bedeutet das: Wer heute automatisiert, muss seine CE-Konformität auf die kommende Verordnung ausrichten, insbesondere dort, wo KI-gestützte Funktionen als Sicherheitsbauteile wirken oder Softwareupdates Maschinensicherheit berühren.
Spannend wird „dunkel“ auch im Hinblick auf Arbeitsschutzrecht und Normen – speziell in Deutschland. Grundsätzlich verlangt die Arbeitsstättenverordnung eine angemessene Beleuchtung, bezogen auf die Sehaufgabe der Beschäftigten; technische Regeln und Normen, z. B. ASR A3.4 und DIN EN 12464, konkretisieren Mindestbeleuchtungsstärken.
Wenn Menschen dauerhaft nicht im Prozessraum arbeiten, verlagern sich die Pflichten: Sicherheits- und Notbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege bleiben zwingend, ebenso die Gefährdungsbeurteilung für Instandhaltung und Eingriffe. „Dunkel“ heißt rechtlich nie „ohne Lichtinfrastruktur“ – es heißt „ohne dauerhafte Nutzbeleuchtung“. Betreiber müssen Fluchtwege, Inspektionspunkte und Interventionsszenarien planen und mit der betrieblichen Organisation der Fernaufsicht verzahnen.
Der EU AI Act spielt auch eine Rolle: Für Fabriken ist relevant, ob eingesetzte Systeme als „Hochrisiko-KI“ gelten – etwa, wenn sie sicherheitsrelevante Funktionen in Maschinensteuerungen beeinflussen oder Qualitätsentscheidungen treffen, die Produktsicherheit berühren. Der Zeitplan ist politisch umstritten, bleibt aber ambitioniert; die Kommission betont die verbindlichen Fristen. Praktisch heißt das: Wer eine Dark-Factory-Architektur plant, sollte früh klären, ob bestimmte KI-Komponenten in die Hochrisikokategorie fallen, welche Daten- und Dokumentationspflichten bestehen und wie diese mit CE-Konformität und Maschinenrecht zusammenspielen.
In Deutschland und Europa gibt es -anders als in China- noch wenig Interesse an Dark Factories in Reinform. Die erwähnten Philips-Linien, die Siemens-Elektronikwerke in Amberg und Erlangen, die hochautomatisierten Halbleiterfabriken in Dresden – sie zeigen, dass Europa „dunkle“ oder „halbdunkle“ Prozesse grundsätzlich beherrscht. Hinzu kommen Logistik- und Fulfillment-Zentren, die zwar nicht „Fabriken“ sind, aber den gleichen Pfad beschreiten: Ocado hat die Orchestrierung tausender Roboter in eng getakteten Gittern perfektioniert und skizziert offen den Weg zum „lights-out warehouse“. Für Deutschland als Industrienation ist die Botschaft zweigeteilt: Die Technik ist verfügbar und wettbewerbsfähig, aber die Blaupause funktioniert vor allem dort, wo Prozesse stabil, Daten reichhaltig und Produkte standardisiert sind.
Bleibt die Schlüsselfrage: sind Dark Factories eine Art Blaupause oder Vorbote für den KI-Umbau der Unternehmen? Der nüchterne Blick trennt Hierarchien. Auf der untersten Ebene dominiert deterministische Automatisierung – SPS, Antriebe, Safety. Darüber laufen datenanalytische KI-Modelle, die Muster erkennen, Abweichungen bewerten und Entscheidungen vorschlagen oder automatisiert treffen. Noch eine Ebene höher – Planung, Scheduling, Lieferketten – kommen Optimierer und zunehmend generative KI zum Einsatz, die Arbeitsanweisungen, Prüfpläne oder Simulationsparameter erzeugt. Die Fabrik „ohne Licht“ ist damit kein Showcase für generative KI, sondern für die saubere Integration von Algorithmen in die industrielle Wertschöpfung: robust, erklärbar, abgesichert.
Die Blaupause für Unternehmen ist weniger die menschenleere Halle als die Fähigkeit, Prozesse durchgängig zu digitalisieren, Daten in verwertbare Modelle zu verwandeln und Verantwortung klar zu regeln: Was entscheidet die Maschine, was der Mensch, und wie wird beides auditierbar. Der Beweis, dass das skaliert, liegt in jenen Werken, die – ob „dunkel“ oder nicht – mit zweistelligen Effizienzgewinnen und Qualitätsraten in die WEF-Liste einziehen. Je höher der Autonomiegrad, umso wichtiger sind die notwendige Erkennung automatischer Wartungsprozesse und eine blitzschnelle Bewertung von Störungen und Alarmfällen, die oft verkettet auftreten können.
Am Ende ist die Dark Factory vor allem eine ökonomische Entscheidung. Bei hoher Reife der Prozesse verschiebt sie die Grenzkosten pro Stück; bei volatilen Produkten drohen dagegen Fehlinvestitionen. Deshalb werden wir mehr „Partial Darkness“ sehen als völlige Finsternis: Nachtschichten ohne Personal, autonome Zellen in sonst bemannten Fabriken, Inseln aus „lights-out“-Bearbeitung rund um Handling und Prüfung. Auch kulturell ist das sinnvoll: Arbeit wandert von der Linie in Leitstand, Instandhaltung und Datenbetrieb. Dort entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit – und dort werden die Engpässe sein, etwa bei Fachkräften für Automatisierungssicherheit, Datenqualität und vernetzte OT/IT-Architektur.
Wer dorthin investiert und gleichzeitig die neuen regulatorischen Pflichten – Maschinenrecht, AI-Act, Sicherheitsbeleuchtung und Gefährdungsbeurteilung bei Eingriffen – vorausschauend organisiert, kann die Dunkelheit für sich arbeiten lassen. Nicht als Selbstzweck, sondern als kalkulierten Vorteil in einer Industrie, die mit Energiepreisen, Demografie und globalem Wettbewerb ringt. Der Trend geht dorthin, wo Produkte und Prozesse es erlauben – und genau dort werden die Hallen zunehmend still, kühl und gelegentlich dunkel sein.
▪
Glossar
-
Lights-out Manufacturing
Bezeichnung für Produktionsstätten, die weitgehend ohne menschliche Präsenz betrieben werden können – theoretisch auch im Dunkeln. Möglich durch Robotik, Sensorik, IT-Steuerung und zunehmend Künstliche Intelligenz.
-
KI im Werk
Künstliche Intelligenz wird vor allem analytisch eingesetzt: zur Prozessoptimierung, Fehlererkennung, Energieeffizienz und Produktionsplanung. Generative KI spielt derzeit eher in Dokumentation und Wissensmanagement eine Rolle.
-
MES
Manufacturing Execution System: Digitale Leitebene zwischen ERP und Maschinensteuerung. Koordiniert Aufträge, Materialfluss, Qualität und Datenerfassung. In Dark Factories zentrale Orchestrierungsinstanz.
-
PLC / SPS
„Programmable Logic Controller“ bzw. „Speicherprogrammierbare Steuerung“ – die technische Basis klassischer Automatisierung. Steuert Maschinenbewegungen, Sicherheitsfunktionen und Prozesslogik.
-
Machine Vision
Bildverarbeitungssysteme, die mit Kameras und Algorithmen prüfen, messen und klassifizieren. In Dunkelfabriken oft gekoppelt mit KI zur Defekterkennung oder adaptiven Qualitätskontrolle.
-
Autonomiegrad
Kennzahl für den Anteil der Prozesse, die ohne menschlichen Eingriff laufen. Vollautonome Fabriken sind noch selten; häufig dominieren Teilprozesse (z. B. Nachtbetrieb ohne Personal).
-
Predictive Maintenance
Vorausschauende Wartung auf Basis von Echtzeitdaten, Schwingungs- oder Temperaturmustern. Ziel: Fehler erkennen, bevor sie auftreten, und Wartung gezielt planen.
-
Digital Twin
Virtuelles Abbild einer Maschine oder Fabrik. Simuliert Prozesse, testet Optimierungen, erkennt Abweichungen. Ermöglicht Fernüberwachung und KI-gestützte Analyse.
-
Kosten und Effizienz
Bis zu 30 % Effizienzgewinn, kürzere Bestandszyklen, geringere Fehlerquoten. Dafür hohe Anfangsinvestitionen, komplexe Integration, längere Amortisationszeiten.
#DarkFactory #LightsOutManufacturing #Industrie40 #SmartFactory #KünstlicheIntelligenz #Robotik #Maschinensteuerung #Automatisierung #VollautomatischeFabrik #DigitaleFabrik #IndustrielleKI #ManufacturingExecutionSystem #MES #PredictiveMaintenance #DigitalTwin #MachineVision #Sensorik #AutonomeProduktion #AutonomeFertigung #DatengetriebeneProduktion #Prozessoptimierung #Produktionsplanung #Fertigung40 #IndustrialAI #SmartManufacturing #IndustrialAutomation #Foxconn #FANUC #SiemensAmberg #SiemensErlangen #BoschDresden #Halbleiterfertigung #Elektronikfertigung #AutomatisierteMontage #SustainabilityLighthouse #GlobalLighthouseNetwork #EUAIAct #Maschinenverordnung #Sicherheitssysteme #SafetyUndSecurity #Datenqualität #Fernwartung #RemoteMonitoring #DigitaleTransformation #IndustrielleTransformation #WirtschaftsstandortDeutschland #NachhaltigeProduktion #Ressourceneffizienz #Effizienzsteigerung #Arbeitsorganisation #Produktionsdatenanalyse #KIinDerIndustrie #AICompliance #AIGovernance #Produktionszukunft #TechnologischeInnovation #IndustrialTransformation #SmartIndustry #VernetzteProduktion #SoftwaredefinierteProduktion #Automatisierungssicherheit #IndustrielleRevolution #WertschöpfungsketteDigital #ZukunftDerFertigung #KIundRobotik #IndustrielleAutomatisierung